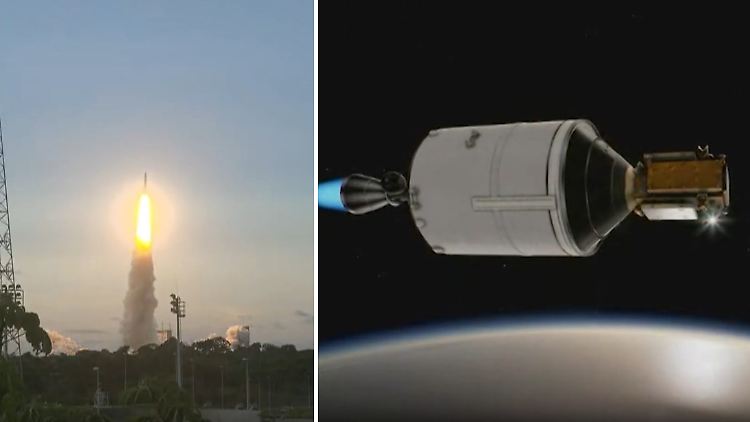Mit Bering in Sibirien Steller vor 300 Jahren geboren
10.03.2009, 09:46 UhrBinnen neun Jahren legte er fern der Heimat 15.000 Kilometer zurück, um Flora, Fauna, Sitten und Bräuche zu erforschen. Der Arzt und Botaniker Georg Wilhelm Steller (1709-1746) erkundete von 1737 bis zu seinem Tod als erster europäischer Naturforscher Sibirien, Kamtschatka und die Aleuten-Inseln. Er beschrieb als erster eine an kaltes Wasser angepasste Seekuh (Hydromalis gigas), die daher Steller'sche Seekuh heißt. Am 10. März jährt sich der Geburtstag des aus Windsheim bei Nürnberg zur Welt gekommenen Sibirienforschers zum 300. Mal.
Steller hatte in Halle und Wittenberg Theologie und Medizin studiert. Zwischen 1731 und 1734 arbeitete er als Hilfslehrer an den Franckeschen Stiftungen in Halle. Danach zog es ihn weit gen Osten: Er war einer von 3000 Teilnehmern von Vitus Berings Kamtschatka-Expedition. Die bis dahin größte wissenschaftliche Expedition hatte die Aufgabe, die Nordküste Sibiriens zu kartographieren und Seewege nach Amerika und Japan zu finden.
"Zwischen Halle und St. Petersburg bestanden schon damals enge Kontakte durch die Franckeschen Stiftungen", weiß der Forscher Wieland Hintzsche, der in den vergangenen Jahren in deren Auftrag Aufzeichnungen von Steller auswertete. Der botanisch interessierte Arzt sei einst auch deshalb nach Russland gegangen, weil er in Deutschland keine Universitätsstelle fand. Er bewarb sich daher an der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, wurde angenommen und zur Verstärkung von Berings Team nach Sibirien geschickt.
Schwierige Forschungsbedingungen
Die Forschungsbedingungen waren nicht einfach: sibirische Kälte im Winter und große Hitze mit vielen Mücken im Sommer. "Die Versorgung durch die Zentrale in St. Petersburg war zudem sehr mangelhaft, das Gehalt kam manchmal mit einer Verspätung von ein, zwei Jahren, die Wissenschaftler waren schon ziemlich zerlumpt", sagt Hintzsche. Auf der Expedition per Schiff und Karren führte Steller fleißig Tagebuch, notierte akribisch seine Beobachtungen über Pflanzen, Tiere und die verschiedenen Völkergruppen. Viele Ortschaften und Pflanzen, die Steller damals noch beschrieben hatte, existieren heute nicht mehr, etwa die ausgerottete Steller'sche Seekuh.
"Die meisten Ergebnisse der Expedition sind noch nie publiziert worden, aber bis heute im Original erhalten", sagt der Hallesche Steller-Experte, der seit 1992 russische Archive durchsucht und Stellers Aufzeichnungen nach und nach publizieren will. 2001 fand er das lange verschollen geglaubte Tagebuch des Gelehrten von der ersten Etappe seiner Forschungsreise. Dort werden Erlebnisse von Steller und Bering beim Überwintern auf einer Insel nahe Kamtschatka geschildert. Auf der Rückfahrt war das Expeditionsschiff St. Peter dort gestrandet. Bering überlebte diesen Winter 1741 nicht. Er starb auf der heute nach ihm benannten Insel.
Immer noch von Bedeutung
Steller erlag fünf Jahre später im Alter von 37 Jahren einem tödlichen Fieber - in Westsibirien. Fast drei Jahrhunderte später sind seine Erkundungen noch immer von Bedeutung; etwa für das Sibirienzentrum am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Der Koordinator des Zentrums, Otto Habeck, interessiert sich vor allem für forschungsgeschichtliche Aspekte: "Wie wurden Forschungsexpeditionen im 18. Jahrhundert organisiert, finanziert und durchgeführt? Was waren die politischen Rahmenbedingungen für große Forschungsunternehmen in jener Zeit? Wie wurden die Ergebnisse ausgewertet und veröffentlicht, wie wurde der Nachlass verwaltet?"
Quelle: ntv.de, Sophia-Caroline Kosel, dpa