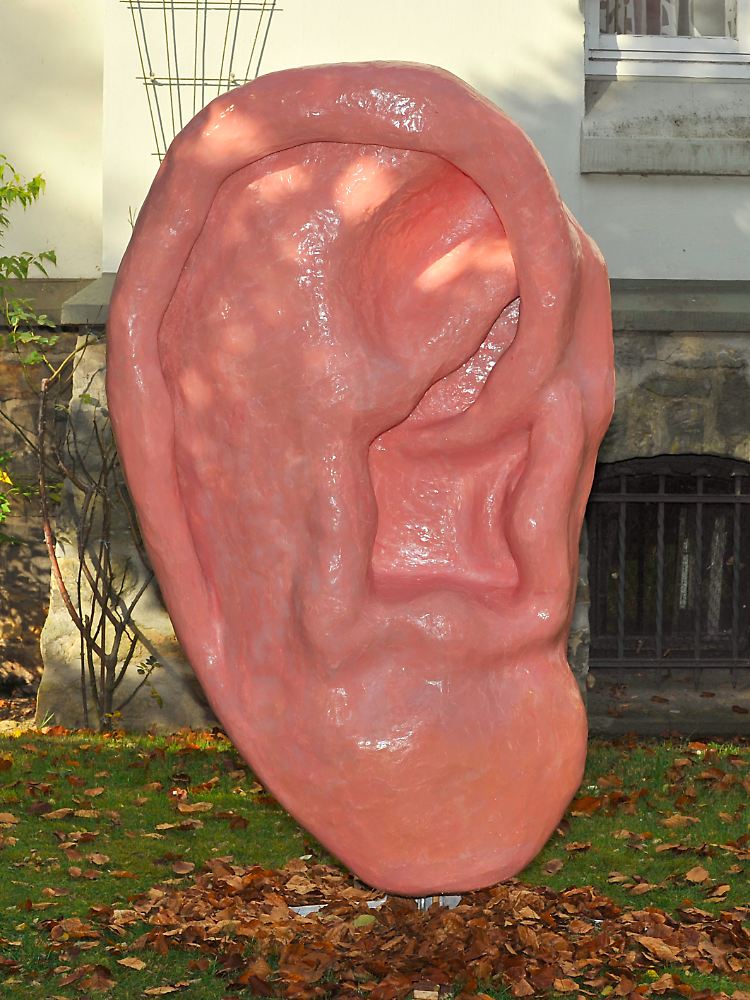Kurzzeitgedächtnis im Hörorgan Töne klingen im Ohr nach
08.04.2011, 15:05 Uhr
Ohren sind sehr empfindlich und werden durch Lärm oftmals überfordert.
(Foto: picture alliance / dpa)
Wir hören Töne mit den Ohren, auch noch, wenn diese längst verklungen sind. Das können Forscher nun beweisen. Wieso das so ist, muss allerdings erst noch erforscht werden.
Durch Töne und Geräusche ausgelöste Schwingungen im Innenohr halten noch an, wenn die Klänge bereits verstummt sind. Wie es zu diesen Nach-Vibrationen kommt, ist bisher nicht genau geklärt. Sie stellen aber scheinbar so etwas wie ein Kurzzeitgedächtnis des Innenohres dar, berichten Wissenschaftler im "Biophysical Journal". Die Entdeckung der Nach-Vibrationen könnte dazu beitragen, bisher rätselhafte Phänomene der Geräuschwahrnehmung zu erklären, etwa die Tatsache, dass für die korrekte Wahrnehmung von Sprache Intervalle einer bestimmten Länge zwischen den einzelnen Tönen liegen müssen.
Das eigentliche Hörorgan, die Schnecke oder Cochlea, liegt im Innenohr. Sie ist wie ein Schneckenhaus gedreht und mit Flüssigkeit gefüllt. Außerdem befindet sich darin die sogenannte Basilarmembran, auf der die Haarzellen sitzen. Wird die Flüssigkeit in der Schnecke durch Schallwellen in Schwingungen in versetzt, werden die Haarzellen umgelenkt. Im Corti-Organ werden die Schallwellen dann letztlich in Nervenimpulse umgewandelt, die ins Gehirn weitergeleitet werden.
Membran schwingt weiter
Einige Haarzellen entwickeln als Reaktion auf die Schwingungen der Basilarmembran eine Kraft, welche die Hörempfindlichkeit steigert. Diese Vorgänge sind nicht völlig verstanden, grundsätzlich jedoch geht man davon aus, dass die Schwingungen und die nachfolgenden Reaktionen enden, sobald die auslösenden Geräusche enden. Dass dies nicht so ist, zeigten die Forscher um Jiefu Zheng von der Oregon Health & Science University (Portland/US-Staat Oregon) nun an Untersuchungen mit betäubten Meerschweinchen.
Sie fanden heraus, dass die Basilarmembran in Abhängigkeit von der Frequenz und Stärke der auslösenden Geräusche nachschwingt. Bereits geringe Einschränkungen im Hörvermögen reduzieren die Nach-Vibrationen erheblich, berichten die Forscher weiter. Mathematischen Modellen zufolge werden die Nach-Schwingungen durch Energie hervorgerufen, die im Corti-Organ nach dem Ende des Stimulus generiert wird. Weitere Untersuchungen seien nötig, um die genauen Mechanismen dahinter zu klären.
Quelle: ntv.de, dpa