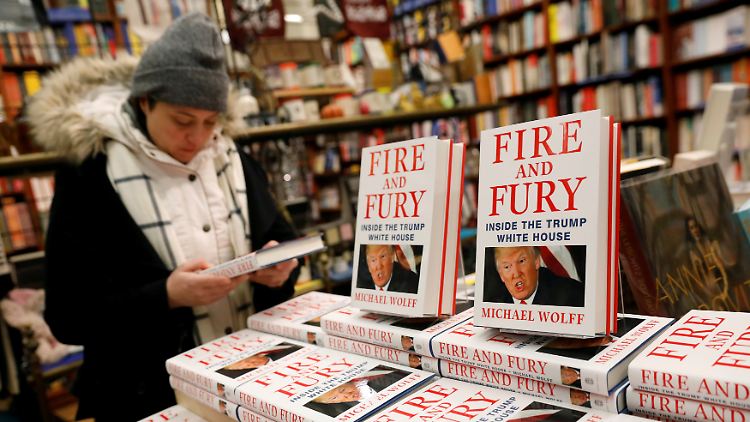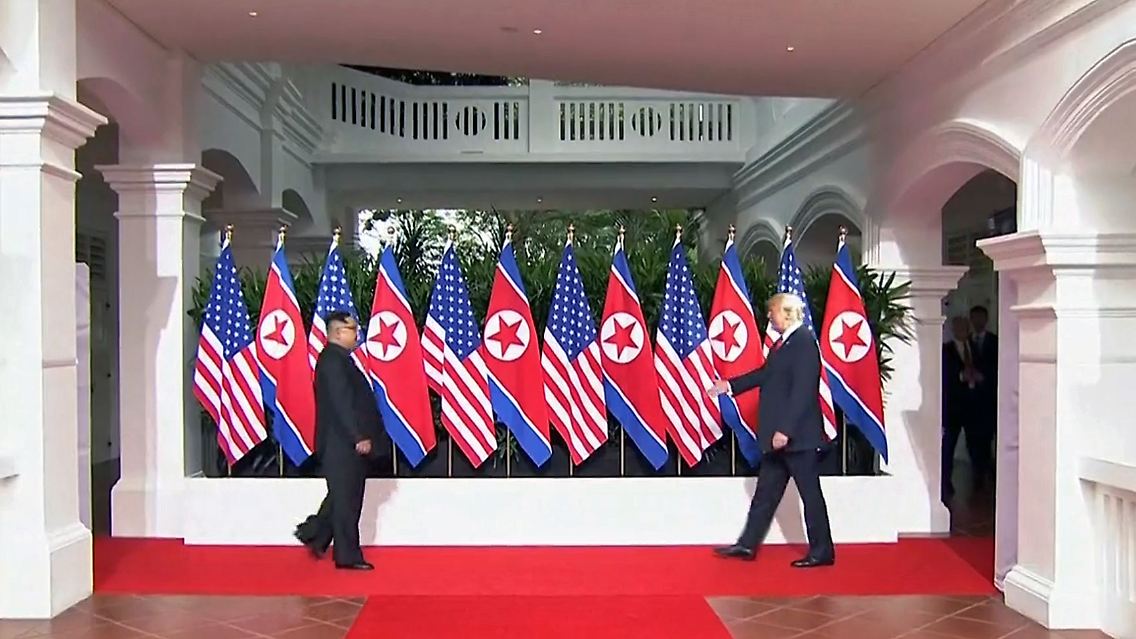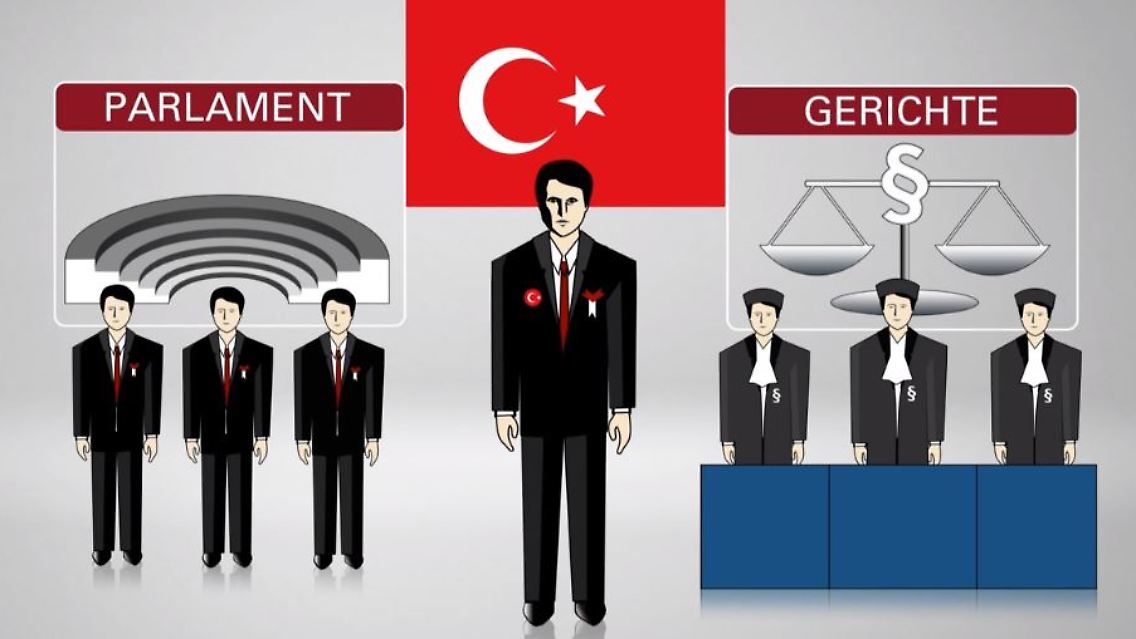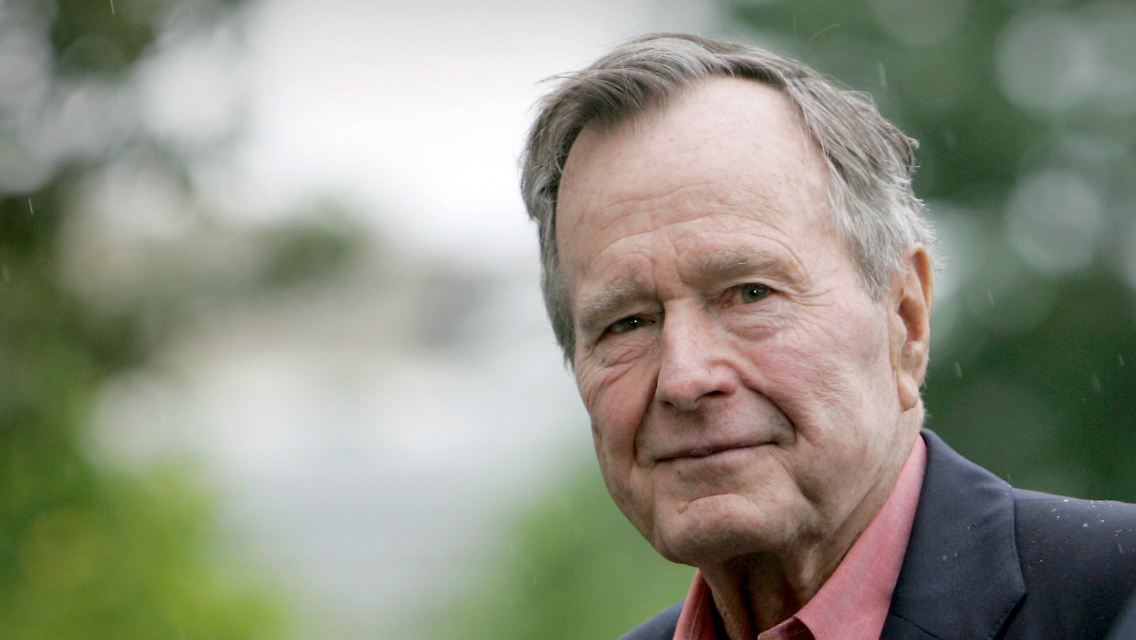Januar: Neue Regierung, ein Trump-Buch, ein Sturmtief
Kennen Sie noch den Herrn rechts? Der heißt Martin Schulz und war vor einer halben Ewigkeit, also 2017, Kanzlerkandidat der SPD. Im Wahlkampf schwor er noch, keine Große Koalition anzustreben. Und dann? Folgte ein für die Nachkriegsgeschichte beispielloses Regierungschaos. Nachdem der FDP-Chef die Jamaika-Sondierungen verlassen hatte, musste die alte Dame SPD noch einmal ran.
Martin Schulz, noch Vorsitzender, führte ab dem 26. Januar die Koalitionsverhandlungen und holte wie auch schon in den Jahren zuvor viel für die Sozialdemokraten heraus. Doch viele in der SPD, allen voran Juso-Chef Kevin Kühnert, hatten keine Lust mehr auf noch eine Regierung mit Merkel. Die Partei quälte sich dann aber doch noch zum Ja zum Koalitionsvertrag. Aus staatspolitischer Verantwortung, wie es hieß. Und viele in Deutschland atmeten auf: Hauptsache eine stabile Regierung.
Doch Aufbruchstimmung kam nicht auf - erst recht nicht, da die GroKo bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 einen Denkzettel erhalten hatte. Und dass Schulz sich selbst zum Außenminister küren wollte, war dann doch zu viel. Zumal er im Wahlkampf nicht nur gesagt hatte, er wolle keine neue GroKo, sondern auch kein Ministeramt. Ein Aufschrei ging durchs Land. Am Ende war Schulz weg und Andrea Nahles wurde neue SPD-Chefin.
Auch Kanzlerin Angela Merkel wirkte angeschlagen, nachdem sie ein Jahr zuvor noch dafür gefeiert worden war, dass sie noch einmal antreten wollte. Es folgte ein turbulentes Jahr, bei dem Neu-Innenminister Horst Seehofer eine tragende Rolle spielen sollte. Aber dazu später mehr. Beide gehören übrigens auch zu unseren Menschen des Jahres. Schauen Sie mal in unsere Bildergalerie!