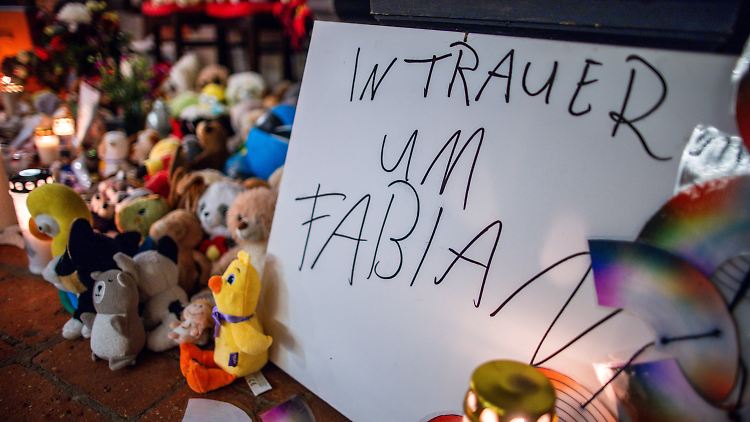Zwischen Hand und Hirn Karl Horst Hödicke, der schnellste Maler
16.12.2020, 18:28 Uhr
Was ein gutes Bild ist sieht man, sagt K.H.Hödicke - hier eine Ausstellungsansicht im Palais Polpulaire in Berlin
(Foto: Matthias Schormann )
Er malt, was er sieht. Die Bilder von Karl Horst Hödicke, kurz K.H. Hödicke, wirken wie "schnell hingeworfen". Typisch für den 82-jährigen Berliner Maler, der aus Nürnberg stammt. Er benutzt Binderfarbe aus dem Baumarkt, statt mit schwerfälligem Öl rumzuhantieren - vor 50 Jahren eine Revolution. Er gilt als Vater der Jungen Wilden, war 30 Jahre lang Professor an der Berliner Hochschule der Künste, hat Künstlergenerationen geprägt. Als die Kunst in den frühen 80er Jahren sehr minimalistisch wurde, begann er mehr und mehr expressiv zu arbeiten. Seine Bilder sind mal abstrakt, zumeist aber klar erkennbar. Seine sehenswerten Malereien sind derzeit im Berliner Palais Populaire und im Münchner Museum Brandhorst zu sehen, momentan leider nur online. Es lohnt dennoch sehr, denn die Wiederentdeckung von Hödicke mit seiner zerstreuenden Leichtigkeit kommt gerade recht. Mit n-tv.de spricht K.H. Hödicke über schnell auf den Punkt gebrachte Bildideen und Bogenschießen im Atelier. Und darüber, warum ein Maler immer ein Maler bleibt.
n-tv.de: Was ist ein gutes Bild?
K. H. Hödicke (lacht, schweigt lange): Ich verweigere die Aussage.
Welches der ausgestellten Bilder ist Ihr Lieblingsbild und warum sollte ich es genauer betrachten?
Oje, alles ist wichtig. Nein, es geht um die Ausstellung als Gesamtes. Die Aussage ist die Ausstellung und nicht dieses oder jenes Bild.
Und was ist die Aussage?
Ich habe die Bilder zwar gemalt, aber die Ausstellung hat Michael Hering von der grafischen Sammlung der Pinakothek der Moderne in München ohne mein Zutun zusammengestellt. Das ist seine Kreation, das ist mir wichtig, denn normalerweise rede ich bei Ausstellungen mit. Hering kam vor drei Jahren zu mir, er wollte meine Papierarbeiten im Museum zeigen. Ich sagte, "die kenne ja ich nicht einmal." Er hat dann anderthalb Jahre sämtliche 5000 Papierarbeiten von mir gesichtet. So was habe ich noch nie erlebt! Die Auswahl, die er getroffen hat, ist seine Sicht auf mich. Er hat es geschafft, mich in einem Licht zu zeigen, wie ich es nicht gewöhnt bin.
Da scheint er einen Schatz gehoben zu haben, denn es werden nicht nur die Papierarbeiten gezeigt, auch Malerei und Skulpturen. Sie arbeiten sehr farbig, dynamisch und die gezeigten Werke sind durchaus auch frech und gerne mit Hintersinn...

Schnelle Bildideen sind fast sein Markenzeichen. Hier Schneemann/Schornsteinfeger von 1990/91
(Foto: (Staatliche Graphische Sammlung München; VG-Bildkunst Bonn 2020))
Sehen Sie das so?
Ja. Das Bild "Dunkles Kaff" beispielsweise: Das dunkle Kaff ist ein kleines weißes Dorf, es ist nur in tiefes Schwarz getaucht. Es könnte auch anders heißen. Oder "Schornsteinfeger und Schneemann" sehen beide aus wie Schneemänner. Wie wichtig ist der Humor in Ihrer Arbeit?
Ich kenne Maler, die ich sehr schätze, die weit davon entfernt waren, Humor zu haben. Nein, das ist keine Kritik, das ist eben deren Persönlichkeit. Malen an sich ist eine andere Kategorie. Man ist wahrscheinlich Maler. Eigentlich sind alle Menschen Maler, ich kenne kaum ein Kind, das nicht malt, das wird ihnen erst in der Schule ausgetrieben. Malerei ist so essenziell wie unsere Sprachentwicklung, und auf dieser Ebene würde ich mich auch verorten.
Wie würden Sie Ihr künstlerisches Werk denn knapp beschreiben?
Ich bin Maler.
Warum malen Sie so gerne und viel auf Papier?
Man sieht es mir heute nicht mehr an, aber ich galt als einer der schnellsten Maler, der rumlief. Daraus habe ich nie ein Hehl gemacht. Früher war ich sehr sportlich und sogar Degenfechter. Diese schnelle Aktion bei einem Zweikampf habe ich in meine Malerei übertragen.
Apropos Sport: Angeblich haben Sie eine Zeit lang Ihr Atelier mit Pfeil und Bogen betreten und Trainingsläufe gemacht. Wenn Sie die 18 Meter entfernte Zielscheibe mehrfach verfehlt haben, sind Sie nach Hause gegangen. Sie haben also Glück oder Zufall über Ihren Arbeitsalltag entscheiden lassen. Stimmt das?
Ja, nehmen Sie das als Geschichte, die schon Wahrheit in sich hat. Es war ein Ritual.
Wie lange haben Sie das betrieben?
Lange, den Bogen gibt es noch, aber ich schieße nicht mehr.
Woher kam die Idee?
Na ja, ich bin Indianer.
Ein Stadtindianer. Gerade in Ihren Berlin-Bildern zeigen Sie eine sich verflüchtigende Stadt, viele Spiegelungen ...
Die Ansichten sind ja auch flüchtig. Wenn man irgendwo steht und etwas sieht, ist es nicht angebracht, die Malerei über Tage und Wochen hinzuziehen. Das muss möglichst schnell zu Papier gebracht werden. Papier ist anders als Leinwand, es ist schneller. Ich male nicht mit Ölfarben und kann damit auch nicht umgehen, sie ist zu zähflüssig. Damit transportiert man Farbe von der Palette auf die Leinwand. Das war für mich nichts. Ich habe meine Farben mit einem Industriebinder selber gemischt. So hat die Malerei übrigens auch auf der Leinwand die Leichtigkeit eines Aquarells.
Die Bildidee muss also schnell aufs Papier?
Ja, damit sie nicht verloren geht. Man sieht unterschiedlich intensiv, wenn man durch die Gegend läuft. Manchmal passiert gar nichts. Ich war in vielen Museen dieser Welt, man kann da auch durchlaufen und nichts sehen, aber mit Glück, sieht man was ...
Demzufolge ist die Frage nach dem einen Lieblingsbild in Ihrer Ausstellung doch berechtigt?
(lacht) Dann müssten Sie aber die Besucher fragen, welches Bild ihnen in Erinnerung bleibt. Ich kann mir das nicht leisten. Mir sind alle meine Kinder lieb.
Nerven Sie Etiketten wie Vater der Jungen oder Neuen Wilden?
Wo ist die Mutter? Nein, im Ernst, es stimmt schon. Es gab in Berlin keinen, der den Pinsel in die Hand genommen hat, den ich nicht dazu angestiftet hätte. 1974, als ich Professor geworden bin, gab es Tendenzen, in denen es hieß, Malen sei kontrarevolutionär. Als sich viele junge Menschen davon beeinflussen ließen, bin ich dagegen angetreten. Das älteste, was wir vom Menschen kennen, sind Malereien. Plötzlich galt Malerei als Spekulationsobjekt und Kapitalismus. Aber das hat mich nicht zur Malerei gebracht.
Was hat Sie zur Malerei gebracht?
Der Trieb. Aber Malen ist auch kontemplativ. In dem Moment, wo Sie malen, bleibt die Welt still stehen. Da spielt Zeit keine Rolle mehr.
Bohren Sie gerne dicke Bretter und verhandeln die großen Fragen, die die Welt bewegen, oder sind es die kleinen Dinge, die für Sie als Künstler interessant sind?
Ach, die Motive, das schwankt sehr. Typisch für einen Berliner bin ich viel verreist. Um der Stadt zu entgehen, war ich viele Jahre in Lappland und hatte eine Fischerhütte in Irland. Ich möchte da nicht wohnen, aber aus der Stadt rauszukommen, hat seine Bedeutung. Wenn sie allerdings auf dem Land auf Motivsuche gehen, gibt es nicht viel.
Was interessiert Sie heute in der Welt?
Ich hoffe, dass es nicht so schiefgeht, wie ich befürchte. Ich glaube, ich bin pessimistischer geworden. Die Möglichkeit, dem zu entgehen, sehe ich allerdings auch nicht. Wir leben in einer Risikogesellschaft, aber diese steuert sich durch Katastrophen. Ob wir das durchstehen, vermag ich nicht zu sagen.
Was regt Sie auf?
Die Pandemie kratzt mich nicht. Ich weiß zwar, es könnte mein Ende sein, aber von dem bin ich ja sowieso nicht mehr weit entfernt. Das zu beantworten, ist schwierig ohne ausfallend zu werden.
Richter, Polke, Lüpertz - alle sind in die Welt gegangen, haben große Karriere gemacht. Sie sind in Berlin geblieben, haben unterrichtet, gemalt - gelebt. Würden Sie das wieder so machen?
Es ist alles in Ordnung so, wie es ist. Sicher habe auch ich mal überlegt, ob ich nicht ins Rheinland muss und habe auch in Düsseldorf ausgestellt. René Block war in Berlin mein Galerist damals. Meine jetzige Galerie König ist ein Betrieb. Block hingegen hat alleine gearbeitet. Er hatte Weltmeister wie Polke, Beuys, Nam June Paik, und keinen hat es interessiert. Klar prägt das. Block musste als Kellner arbeiten, um seinen Laden im Souterrain am Laufen zu halten. Natürlich gab es ein paar Käufer, aber die Insellage und die Tatsache, dass Berlin keine Stadt der Maler war, hat es nicht leicht gemacht.
Gerhard Richter legt jetzt den Pinsel aus der Hand und sagt, irgendwann ist eben Ende. Was sagen Sie dazu? Hört man als Künstler einfach auf, geht das wirklich?
Nein, ich glaube das nicht. Große Bilder male ich nicht mehr, das geht physisch nicht. Wenn ich mich auf den Boden legen würde, um ein vier Meter großes Bild zu bearbeiten, würde ich nicht mehr hochkommen. Aber ich mache jeden Tag ein halbes Dutzend Zeichnungen, ich würde sonst anfangen mich zu langweilen.
Welche Funktion hat Kunst in ihren Augen?
Die ist bedeutender als sie derzeit eingeschätzt wird. Leider steht die bildende Kunst nicht mehr im Mittelpunkt. Ich finde es beispielsweise nicht sehr glücklich, die Hochschule der Künste in Universität umzubenennen. Maler sind auch Handwerker, es ist die Verbindung zwischen Hand und Hirn - darum geht es doch.
Noch einmal die Frage vom Anfang: Was ist ein gutes Bild?
Das sieht man.
Mit K. H. Hödicke sprach Juliane Rohr
K. H. Hödicke ist bis zum 4. April im Palais Populaire, Unter den Linden 5, 10117 Berlin zu sehen und online hier
Spot On: German Pop mit Werken von K.H. Hödicke läuft bis zum 30. Juni 2021 im Brandhorst Museum, Theresienstraße 35a, 80333 München
Quelle: ntv.de