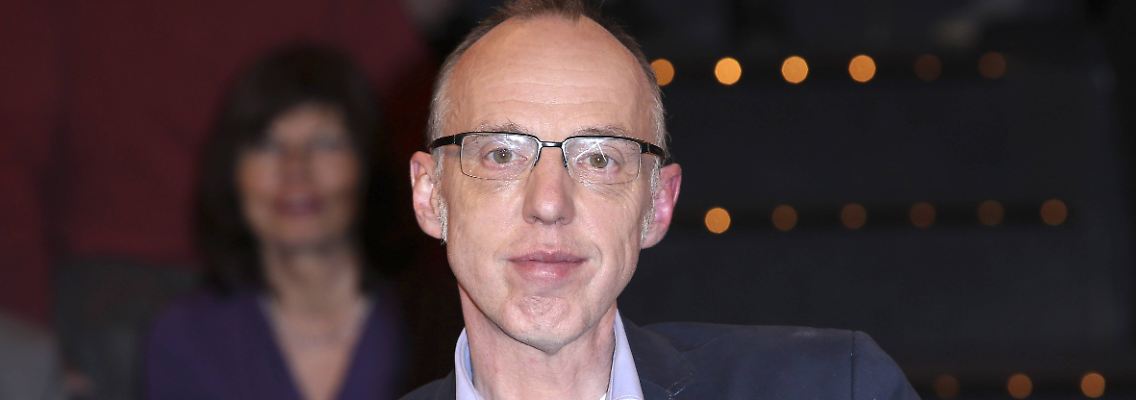Ständige Angst vor dem Tod Wenn Hypochondrie das Leben beherrscht
07.05.2021, 18:31 Uhr
Hypochonder haben Angst vor einer schweren, meist tödlich verlaufenden Erkrankung. Sie horchen viel in sich hinein und greifen auch gern zu Medikamenten.
(Foto: picture alliance / Zoonar)
Hypochondrie hat für die betroffenen Menschen gravierende Folgen. Verstärken sich die Effekte während der Corona-Pandemie noch, mit der Angst vor dem Virus? Forscher sehen überraschende Ergebnisse. Eine andere Entwicklung bereitet ihnen Sorge.
Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass Menschen ganz unterschiedlich mit der Angst vor dem Virus umgehen: Während manche aus Furcht vor einer Ansteckung penibel auf die Einhaltung aller Schutzmaßnahmen und die eigene Gesundheit achten, tun andere ein derartiges Verhalten als "Hypochondrie" ab. Dabei bezeichnet der Begriff nicht etwa allgemeine Krankheitsängste, sondern eine eng definierte psychische Störung mit gravierenden Folgen für Betroffene - die aber überraschenderweise gerade unter der Pandemie nicht besonders leiden.
Dabei hätte das Krankheitsbild dies durchaus vermuten lassen: Menschen mit dem Vollbild einer Hypochondrie haben Angst vor einer schweren, meist tödlich verlaufenden Erkrankung. Oft handelt es sich dabei um tödliche Krebsarten, aber auch um neurodegenerative Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Demenz.
Besuch beim Arzt beruhigt nur kurzzeitig
"Nicht jede Angst im Kontext von Gesundheit ist also ein Symptom für Hypochondrie", erläutert Winfried Rief, Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Marburg. Vielmehr sei die Hypochondrie dadurch gekennzeichnet, dass beispielsweise auch ein Besuch beim Arzt nur eine kurzzeitige Beruhigung bringe, ergänzt Michael Witthöft, Professor für Klinische Psychologie an der Universität Mainz. Er spricht in diesem Kontext von "pathologischen Krankheitsängsten", da die Bezeichnung Hypochondrie stark belastet sei.
Tatsächlich werden Betroffene in der Öffentlichkeit immer noch gerne mal als wehleidig oder hysterisch belächelt. "Derartige Stereotype sind in höchstem Maße schädlich, weil sie die Menschen in die Isolation treiben", gibt Rief zu bedenken. "Angesichts der Vorurteile sprechen die Erkrankten nicht mehr über ihre Ängste. Dieses Schweigen führt dazu, dass sie in jenen Ängsten völlig gefangen sind."
"Keine kleine Wohlstandsmarotte"
Für den Psychologen steckt in der Abfälligkeit gegenüber dem Krankheitsbild auch Arroganz: "Es wird so getan, als wären Hypochonder anders als andere Menschen. Dabei handelt es sich zunächst um ganz normale psychologische Dynamiken, die außerhalb der Hypochondrie zum funktionalen Leben beitragen und in der Hypochondrie an gewissen Stellen dysfunktional und überzeichnet werden." In der Öffentlichkeit fehle das Bewusstsein dafür, dass es sich um eine schwere Erkrankung handele. "Die Ängste eines Hypochonders sind von einer Intensität, wie sie niemand haben will, und keine kleine Wohlstandsmarotte", betont Rief.
Anders als bei anderen Angsterkrankungen sind von Hypochondrie Frauen und Männer fast gleich betroffen. Die Haupterkrankungszeit liege oft zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr, so Michael Witthöft. "In der mittleren Lebensphase kommen häufig psychosoziale Stressoren aus der Berufstätigkeit oder Familiengründung zusammen, die dazu führen können, dass die Krankheit ihr Vollbild erreicht." Daneben gebe es allerdings auch Fälle, die schon in der Adoleszenz oder später im Leben aufträten.
Strategien, um mit den Ängsten umzugehen
Betroffene entwickelten verschiedene Strategien, um mit den alles beherrschenden Ängsten umzugehen. Dazu könne etwa gehören, sich im eigenen Umfeld oder bei Ärzten immer wieder zu vergewissern, dass die Schluckbeschwerden kein Hinweis auf Kehlkopfkrebs seien, so Rief. Ein weiterer Mechanismus sei das zwanghafte Suchen nach entlastenden Informationen im Internet: "Meist stoßen Betroffene hier aber genau auf das Gegenteil, so dass die Besorgnis sogar zunimmt und weiter online gesucht wird", beschreibt Witthöft das Phänomen, das auch als "Cyberchondrie" bekannt ist. Und schließlich ist auch die zwanghafte Überprüfung des eigenen Körpers, wenn zum Beispiel Lymphknoten oder Hautstellen immer wieder abgetastet werden, ein Versuch, die Ängste zu bewältigen.
Welche Faktoren genau dazu führen, dass jemand im Laufe seines Lebens eine Hypochondrie entwickelt, ist noch nicht im Detail geklärt. Eine große Rolle spielen frühe Erfahrungen mit den Themen Krankheit und Tod. "Ein überfürsorgliches Elternhaus kann sich ebenso auswirken wie eines, in dem Schmerzen ignoriert werden", zählt Psychologe Rief weiter auf. Hinzu komme der Persönlichkeitsfaktor Neurotizismus, so Witthöft. Mit diesem sind unter anderem eine Neigung zu Nervosität, Unsicherheit und Ängstlichkeit verbunden.
Keine Beschwerden "erst, wenn man tot ist"
Dazu spielen indes auch gesellschaftliche Aspekte eine Rolle. "Wir erwarten heutzutage einen Perfektionismus des Funktionierens unseres Körpers, wie das noch nie der Fall war", sagt Rief und illustriert: "Ich habe auf dem Land gewohnt. Wenn der Bauer, bei dem man die Milch geholt hat, sagte, dass ihm der Rücken weh tut, dann war das für ihn keine Krankheit, sondern hat zu seinem Beruf dazugehört. Heute geht es uns in so vielen anderen Bereichen besser als früher, also soll es uns auch körperlich besser gehen." Eben dies beschreibe auch die Falle, die sich für hypochondrische Patienten stelle: Das gesellschaftliche Bild erzeuge die Fehlerwartung, dass Gesundheit die Abwesenheit körperlicher Beschwerden bedeute. "Diesen Zustand erreicht man aber erst, wenn man tot ist", spitzt Rief zu.
Der Psychologe unterstreicht zudem, dass alle Menschen immer wieder Krankheitsängste hätten, mit denen sie mal mehr, mal weniger gut umgehen könnten: "Jetzt zu Covid-Zeiten gibt es beispielsweise viel mehr Menschen, die schwer damit zurechtkommen, als es Hypochonder gibt."
Aufkommen einer pathologischen "Covid-Angst"?
Laut Peter Tyrer vom Londoner Imperial College stellten wachsende Gesundheitsängste aufgrund von Covid-19 gar einen bislang vernachlässigten Aspekt der Pandemie dar. In einem Meinungsartikel für das Fachblatt "World Psychiatry" schreibt der Psychiater, dass vermutlich noch über Jahre ein zumindest latentes Infektionsrisiko von dem Virus ausgehen werde. Er prophezeit daher das Aufkommen einer spezifischen pathologischen "Covid-Angst", auf die sich Gesundheitssysteme weltweit vorbereiten sollten.
Für Michael Witthöft ist das eine kühne These: "Eine solche Aussage schürt auch eine Art negativer Erwartungshaltung, der zufolge wir kurz vor einer psychologischen Pandemie stehen. Diese erwarte ich allerdings weder in dieser Form noch in dieser Vehemenz, weil Krankheitsängste in der überwiegenden Zahl der Fälle temporäre Phänomene sind, die kurzzeitig ansteigen und dann nach einem Viertel- bis halben Jahr auch wieder zurückgehen." Nur zu einem geringen Anteil würden derartige Ängste chronisch und bewegten sich in Richtung Hypochondrie, was auch die geringe Prävalenz des Vollbildes von einem Prozent der Bevölkerung und weniger zeige: "Es müssen also verschiedene Komponenten zusammenkommen, damit sich die Krankheit entwickelt - eine Pandemie allein reicht nicht."
Mehr Krankheitsängste in erster Corona-Welle
Nichtsdestotrotz sei richtig, so Witthöft, dass Krankheitsängste im Allgemeinen zumindest in der ersten Corona-Welle in Deutschland zugenommen hätten, wie eine Erhebung seines Instituts belegte. Dieser Befund sei wahrscheinlich auf einen Anpassungsmechanismus zurückzuführen: "Wir sind mit einer für unsere Gesundheit bedrohlichen Situation konfrontiert und da stellt es vermutlich eine adäquate Reaktion dar, mit einer erhöhten Aufmerksamkeit und entsprechenden Sorgen um den eigenen Körper zu reagieren." Jene Ängste seien aber bei den meisten Menschen schnell zurückgegangen.
In einer weiteren Befragung konzentrierten sich Witthöft und seine Kollegen auf Menschen, die sich bereits aufgrund von Hypochondrie in Behandlung befanden: "Wir hatten die Hypothese, dass diese in der Pandemie besonders leiden." Tatsächlich aber war genau das nicht der Fall - eine Beobachtung, die dem Psychologen zufolge auf den zweiten Blick durchaus plausibel sei: "Menschen, die völlig absorbiert waren mit dem Gedanken, sie könnten unter Krebs leiden und nicht mehr lange leben, haben keine kognitiven Ressourcen, um sich ausgiebig mit dem Thema Corona auseinanderzusetzen." Entsprechend stellten Menschen mit Hypochondrie nicht unbedingt eine besonders vulnerable Risikogruppe in der Pandemie dar.
Impfangst bei Hypochondern
Anders hingegen Menschen, die schon vor der Pandemie eine erhöhte Besorgnis, eine psychische Störung oder ein erhöhtes Depressionsniveau hatten: "Diese Gruppen tendieren vermehrt zu entsprechenden Ängsten und dann unter Umständen auch zu einer Art kontraproduktivem Schutzverhalten, was dann wieder dazu führt, dass die Ängste mehr werden", beschreibt Witthöft. Insgesamt lasse sich aber noch nicht sagen, ob die Pandemie bei Menschen, die schon zu Krankheitsängsten neigten, zu einer Ausprägung des Vollbilds der Hypochondrie führt.
Was sich indes schon jetzt beobachten lasse, sei, dass die Pandemie Gesundheitsängste an unterschiedlichsten Stellen manifestiere und sich diese auch veränderten, erklärt Winfried Rief: Ein Teil der Menschen mit derartigen Ängsten verlagere sie auf die Impfungen. Dabei sei, so Rief, die Impfbereitschaft letztlich die entscheidende Frage zur Bewältigung der Pandemie. Entsprechend macht ihm vor allem die große Zahl von Menschen Sorgen, die sich aus Angst vor Nebenwirkungen nicht impfen lassen wolle: "Das ist natürlich nicht das Vollbild einer Hypochondrie, doch letztendlich steckt die gleiche Dynamik dahinter."
Quelle: ntv.de, Alice Lanzke, dpa