Ampel in der KriseEine Neuwahl führt zu: absolut gar nichts
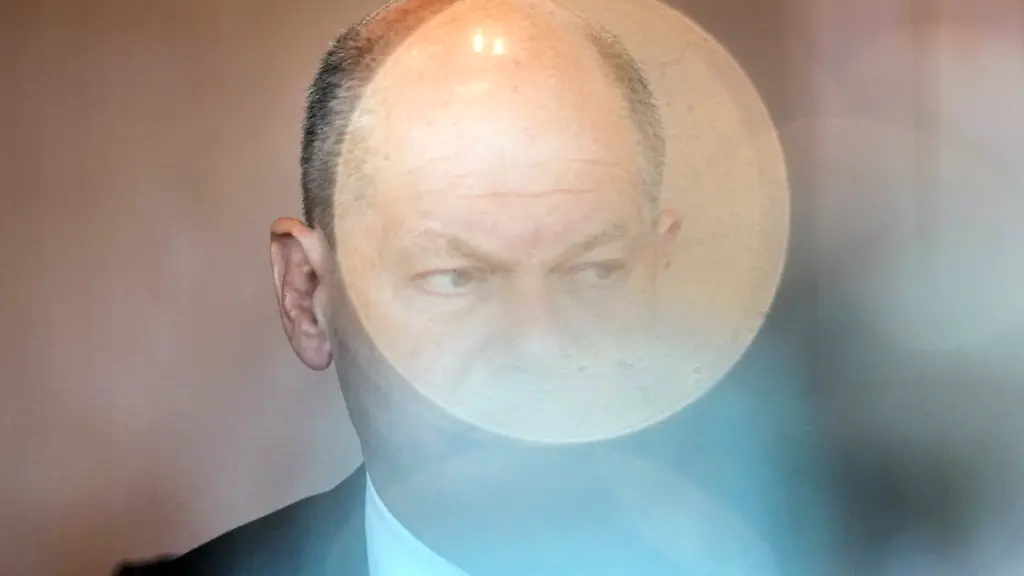
Die Ampel streitet schier endlos, Olaf Scholz ist ein schlechter Kanzler. Es ist nur logisch, dass der Ruf nach einer vorgezogenen Wahl erschallt. Nur was bringt die, angesichts der fragmentierten Parteienlandschaft? Noch mehr Frust und Ansehensverlust des Parlamentarismus.
Man muss kein Kenner der Materie und kein Prophet sein, um zu erahnen: Wenn die Union die Bundestagswahl 2021 gewonnen und Armin Laschet als Kanzler eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, Grünen und FDP gebildet hätte, wäre es jetzt die Partei von Annalena Baerbock und Robert Habeck, die in Umfragen im einstelligen Bereich liegen würde, vielleicht sogar um den Wiedereinzug ins Parlament zittern müsste. Ähnlich wie Rot-Grün steht sich Schwarz-Gelb politisch weitaus näher. Union und FDP hätten die Grünen gezwungen, deutliche Abstriche an ihren Anliegen zu machen, um Kompromisse zu ermöglichen. Genau den Part hat die FDP in der Ampel übernommen - und wird dafür von ihren (bisherigen) Anhängern hart bestraft.
Dabei muss man sich bei der Partei von Christian Lindner nach wie vor bedanken, in das Bündnis eingewilligt zu haben, obwohl er und seine Mitstreiter von Anfang an gewusst haben, worauf sie sich einlassen. Aber nochmals konnte die FDP nicht ausscheren und wie 2017 erklären: "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren." Dann wäre nur noch eine Koalition aus Union und SPD möglich gewesen, von der die Bevölkerung nach den Merkel-Jahren die Nase voll hatte. Außerdem wollten Lindner, Baerbock und Habeck regieren. Dafür sind sie einst in die Politik gegangen.
So entstand die Ampel-Koalition mehr oder weniger aus der Not heraus - ein Produkt aus tiefer Zuneigung war sie nie. Die Regierungspartner übernahmen, was gut und richtig war, Verantwortung für das Land, getrieben von einer Konstellation, die durch die zunehmende Fragmentierung der deutschen Parteienlandschaft und die Stärke der AfD entstanden war. Dass sich das Trio von Beginn an klar darüber war, dass da zusammenwachsen soll, was eigentlich nicht zusammengehört, zeigte sich schon ganz vorn in einer Passage des Koalitionsvertrags, in der auf "unterschiedliche Traditionen und Perspektiven" der drei Parteien verwiesen wird.
Kompromiss auf kleinstem gemeinsamem Nenner
Habeck sah im Wahlergebnis weder "ein klares Mandat" noch "eine klare Richtung für eine Regierung", forderte aber, weil "die Herausforderungen einfach zu groß und zu dominant sind", Schluss zu machen mit "dem Gewürge" von Union und SPD, der "Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners" und "des ewigen Kompromisses". Die Bestandsaufnahme war richtig, nur mit seiner Prognose zur Ampel lag der Minister arg daneben. Er glaubte: "Alle Parteien werden in der Regierung wachsen." Und Olaf Scholz verkündete: "Uns eint der Wille, das Land besser zu machen, es voranzubringen und es beisammenzuhalten. Es geht uns nicht um eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern um eine Politik der großen Wirkung."
Mittlerweile wird in der Bevölkerung aufgeatmet, wenn nach Wochen oder Monaten des Gewürges ein Kompromiss auf kleinstem gemeinsamem Nenner gefunden wird und die Einigung den Eindruck des totalen politischen Stillstands verdrängt. Was aus den Ankündigungen und Versprechungen der selbst ernannten Fortschrittskoalition, die nach 16 Jahren Mehltau der Ära Angela Merkel Hoffnung auf bessere Zeiten verströmten, geworden ist, zeigte sich spätestens bei der Europawahl, bei der die Ampel kollektiv abstürzte. Inzwischen hat jeder Bürger im Land mitbekommen, dass SPD, Grüne und FDP Defizite in der handwerklichen und kommunikativen Regierungsarbeit haben, Scholz ein schlechter Kanzler ist und noch weniger Lust auf Reformen hat als seine CDU-Vorgängerin.
Es ist also nur logisch, dass der Ruf nach einer Neuwahl erschallt und die Union am lautesten danach schreit, weil sie gerade in den Umfragen weit vorn liegt. Die Frage ist nur: Was sollte das bringen, außer noch mehr Frust und Ansehensverlust für die etablierten Parteien und das parlamentarische System? Es käme ja kein glasklares Ergebnis für das linke oder das bürgerliche Lager heraus - mit der AfD will bekanntlich niemand koalieren. Sollten FDP und Linke aus dem Bundestag fliegen sowie die Wagenknecht-Partei den Einzug ins Parlament schaffen, bliebe womöglich nur ein Bündnis aus Union und SPD, das schlimmstenfalls die Grünen für eine Mehrheit bräuchte. Dann begänne alles von vorn: der Streit über die Schuldenbremse, die Migrationspolitik, das Vorgehen gegen kriminelle Ausländer und, und, und.
Realpolitik ist out
Die Konflikte werden nicht weniger. CDU und CSU müssen erst einmal beweisen, dass sie das schaffen, was die SPD im Wahlkampf 2021 exzellent vormachte: sich nicht zu kloppen. Sogar Kevin Kühnert, früher kein Freund von Scholz, nahm sich konsequent zurück und unterstützte seinen Genossen als Kanzlerkandidat und inzwischen als Regierungschef ohne Wenn und Aber. Die Geschlossenheit in der SPD ist erstaunlich, obwohl jeder weiß, dass sie mit Scholz als Frontmann chancenlos sein wird, wen immer die Union gegen ihn antreten lässt. Der Sozialdemokrat hat nur eine realistische Chance, Regierungschef zu bleiben, wenn sich CDU und CSU wie 2021 im offenen Kampf um die Kanzlerkandidatur zerlegen.
Der Wahlkampf wird - ob jetzt oder ein Jahr später - aller Wahrscheinlichkeit nach der gruseligste, den das Land je erlebt hat: irgendwo zwischen banal, gaga, populistisch und hetzerisch. Denn wer den Leuten die Wahrheit sagt, was auf die Republik zukommt, und nicht verspricht, dass wieder alles so heil sein wird wie vor Russlands Einfall in die Ukraine, hat schlechte Karten. Realpolitik ist out, in sind uneinlösbare Heilsversprechen. Das ist nur exakt das, was Deutschland schon jetzt zur Genüge hat.
Allerdings werden die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg zu weiterer Polarisierung führen. Vor allem Sachsen und Thüringen stehen vor der Unregierbarkeit, sollte die CDU nicht doch der AfD das Tor zum Mitregieren öffnen, was nicht zu erwarten ist: Friedrich Merz ist nach allem, was man hört, strikt dagegen. Und während die Republik auf den Osten schaut, soll auf den Straßen um Stimmen für eine vorgezogene Wahl im Bund gerungen werden? Das bringt nur noch mehr Verdruss und Spaltung. Die Menschen werden noch müder und verdrossener. Dann nähert sich Deutschland italienischen Verhältnissen, wo die Menschen permanent zu den Urnen gerufen werden und die Beteiligung regelmäßig Tiefststände erreicht.
Die Hoffnung, dass eine Koalition aus Union und SPD mit Grünen oder FDP besser funktioniert als die Ampel, ist Wunschdenken. Verhandlungen über das Bündnis könnten mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten zusammenfallen - Deutschland wäre quasi wochen- oder monatelang regierungslos. Hierzulande würde das bei den Führungsqualitäten von Scholz niemand merken - im Ausland aber schon. Das wiederum kann wirklich niemand wollen, erst recht nicht die Ukraine.
Auch wenn die Hoffnungen auf Besserung minimal sind: Die Ampel sollte zusehen, die verbleibenden Monate - der Wahlkampf kommt früh genug - zu nutzen und ihr Nonstop-Versprechen endlich erfüllen, sich zusammenzuraufen, statt sich weiter und weiter zu zoffen. Sie muss oder sollte zeigen, dass Politik auch und doch noch anders kann. Damit wäre dem Land eher gedient als eine vorverlegte Wahl mit anschließender Bildung der nächsten fragilen Koalition mit drei oder vier Partnern, die nicht miteinander können, aber müssen.