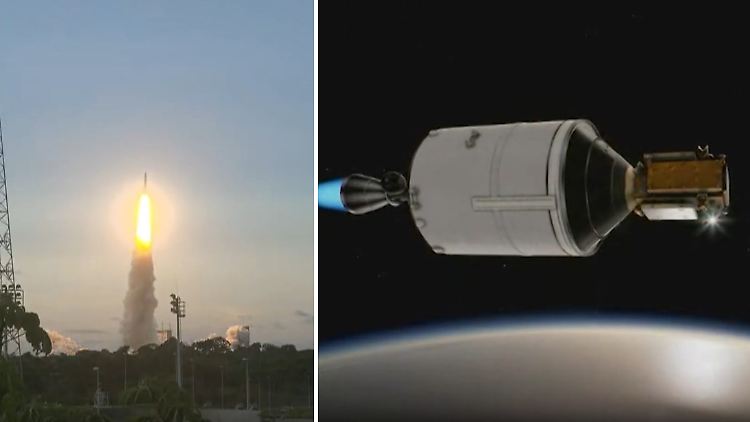Bei Meldungen über das eigene Land Deutsche merken sich "Good News" besser
13.09.2016, 10:47 Uhr
Junge Menschen greifen immer seltener zur echten Zeitung.
(Foto: imago stock&people)
Egal ob positiv oder negativ: Nachrichten sind allgegenwärtig. Dennoch merkt man sich einige besser als andere. Welche Nachrichten unter welchen Umständen junge Menschen am besten im Gedächtnis behalten, haben Forscher geklärt.
"Only Bad News Are Good News" lautet eine alte Weisheit im Nachrichtengeschäft. Dass diese gar nicht immer stimmt, haben Wissenschaftler der Universität Hohenheim und der Ohio State University zusammen herausgefunden.
Für ihre Untersuchung gaben die Forscher 119 Probanden in den USA und 245 in Deutschland verschiedene Zeitungsartikel zum Lesen. Die Testpersonen wurden komplett aus der Studentenschaft gewonnen. "Zwei Texte beschäftigten sich mit Bildung und der nationalen Sicherheit – beides Themen, die für junge Leute sehr wichtig sind", erklärt Professor Sabine Trepte die Inhalte. Bei jeweils der Hälfte der Probanden war Deutschland in den beiden Artikeln positiver dargestellt als die USA, bei der anderen Hälfte war es umgekehrt. Zwischen den beiden Texten gab es jeweils einen sogenannten Störtext mit neutralem Thema, der vom Ziel der Studie ablenken sollte.
Danach sollten die Studienteilnehmer Fragen der Forscher zum Inhalt beantworten. "Wir wollten sehen, ob die für das eigene Land positive oder negative Färbung eines Artikels dazu führt sich die Inhalte besser zu merken", erklärt die Medienpsychologin die Vorgehensweise. Die Auswertungen der Daten brachten eindeutige Ergebnisse. Deutsche behalten positive Nachrichten über das eigene Land deutlich besser im Gedächtnis als negative. Bei den US-Amerikanern dagegen, konnte dieser Effekt nicht erkannt werden.
Identitätsproblem und weniger Zeitungslektüre
Als ein Grund sehen die Forscher die Tatsache, dass Jugendliche und junge Erwachsene wesentlich weniger Zeitung lesen als früher. "Sie bilden sich daher, wenn sie Artikel vorgelegt bekommen, zunächst eine undifferenzierte Meinung. Erst ein Vergleich der eigenen sozialen Gruppe – in den vorgelegten Texten die Nationalität – mit einem relevanten Partner schaffe Aufmerksamkeit." Darauf springen die Menschen gewissermaßen an." Den Unterschied zwischen den beiden Ländern erklärt die Forscherin damit, dass in Deutschland das Lesen von politischen Texten doch noch wesentlich verbreiteter ist als in den USA. Zudem wäre ein Identitätsproblem denkbar. Die Frage, wie man heute im Vergleich mit anderen steht, ist für Deutsche wichtiger als den meisten US-Amerikanern.
Es ist klar, dass auf Grundlage dieser Erkenntnisse nicht alle Texte positiv geschrieben sein können. Dennoch könnten sich Schulen und andere Bildungsstätten diesen Effekt sinnvoll nutzen.
Quelle: ntv.de, jaz