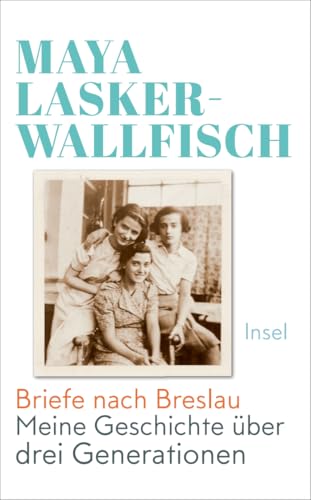Im Schatten der Shoah"In Auschwitz gibt es keinen Platz für Sprache"

Eine neue Doku beschäftigt sich mit den Schatten, die die NS-Verbrechen bis heute auch auf nachfolgende Generationen werfen. Protagonistin ist Maya Lasker-Wallfisch, die Tochter der Shoah-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch. Im Interview mit ntv.de spricht Maya Lasker-Wallfisch über ein Treffen mit den Nachfahren des NS-Massenmörders Rudolf Höß.
In der Dokumentation "Der Schatten des Kommandanten" begibt sich Maya Lasker-Wallfisch auf eine Spurensuche in die Vergangenheit. Die Tochter der Auschwitz-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch ergründet ihre jüdisch-deutschen Wurzeln. Der Film beschäftigt sich mit den langen Schatten, die die NS-Verbrechen auf nachfolgende Generationen werfen. Dabei treffen Mutter und Tochter Lasker-Wallfisch auf die Nachfahren des Nationalsozialisten Rudolf Höß. Höß war Kommandant des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz und verantwortlich für die Ermordung von mehr als einer Million Jüdinnen und Juden. "Ich wusste nicht, wie ich mich in ihrer Gegenwart fühlen würde", sagt Lasker-Wallfisch im Interview mit ntv.de. "Die Stille war der bewegendste Moment zwischen uns Dreien", beschreibt sie den gemeinsamen Besuch in Auschwitz.
ntv.de: Für den Film hat Regisseurin Daniela Völker Sie 2020 bei den Vorbereitungen Ihres Umzuges nach Deutschland begleitet. Warum sind Sie nach Deutschland gezogen?
Maya Lasker-Wallfisch: Ich bin als Tochter einer deutsch-jüdischen Überlebenden der Shoah in London geboren. In meinem Leben habe ich immer das Gefühl gehabt, nicht dazuzugehören. Ich war stets eine Außenseiterin. Erst mit 50 Jahren, als ich anfing, mich mehr mit transgenerationalem Trauma zu beschäftigen, habe ich verstanden, dass ich für das Vermächtnis meiner Mutter verantwortlich bin. In diese Verantwortung musste ich reinwachsen. Ich wollte verstehen, wo ich herkomme und wissen, ob ich mich in Deutschland zugehörig fühlen würde, ob es hier einen Platz für mich gäbe. Was ich hier in Deutschland gefunden habe, ist sicherlich nicht einfach. Aber im Großen und Ganzen hat es sich gelohnt.
Was hat sich seit dem 7. Oktober 2023 für Sie verändert?
Vorher hatte ich nie Angst, Jüdin zu sein. In den ersten Monaten danach hatte ich Angst. Aber ich habe mich daran gewöhnt und die Angst wird langsam immer weniger. Es ist jetzt das neue Normal geworden, dass wir einen Krieg erleben. Ich fühle mich sicher, aber das Gefühl ist prekär. Antisemitismus gibt es überall, aber in Deutschland fühlt es sich anders an. Hier fühle ich es körperlich. Ein Hakenkreuz in London zu sehen, ist schrecklich. Aber wenn ich das Symbol hier sehe, fehlen mir die Worte.
Und fühlen Sie sich in Deutschland zugehörig?
Ich bin mir nicht sicher. Bis heute weiß ich nicht, was es bedeutet, dazuzugehören. Ich würde gerne einbezogen werden. Ich möchte nicht vergessen werden. Nachdem ich nach Deutschland gezogen bin, war es für mich anfangs sehr seltsam, "Frau Lasker-Wallfisch" zu hören. Ich schaute mich dann nach meiner Mutter um. Es hat etwas Zeit gebraucht, zu realisieren, dass das auch mein Name ist. Ich kann ihren Platz nicht einnehmen! Aber unweigerlich bin ich diejenige, die hier ist, und ich möchte ihre Arbeit auf meine eigene Weise fortführen. Als Überlebende der Shoah erklärt sie vielen Menschen ihre Vergangenheit. Diese Arbeit möchte ich fortsetzen.
Nach ihrer Befreiung aus dem Konzentrationslager zog ihre Mutter 1945 nach London. Dort lebt Sie bis heute. Während der Dreharbeiten besuchte ihre Mutter Sie hier in Berlin. Wie war das für Sie beide?
Als sie in meine Berliner Wohnung kam, sagte meine Mutter, die Wohnung sei wie ein Mausoleum. Aber sie war auch beeindruckt. Das Seltsame war, dass in ihr viele Erinnerungen hochkamen. Sie erzählte mir Dinge, über die sie vorher nie mit mir gesprochen hatte oder an die sie sich nicht erinnern konnte. Meine Wohnung verglich sie mit ihrer Kindheitswohnung in Breslau, wo sie aufwuchs. Es ist wundervoll, all diese Geschichten zu hören und gleichzeitig bittersüß - eine verlorene Welt.
Ihre Großeltern wurden 1942 nach Izbica deportiert und dort ermordet. Während der Dreharbeiten haben Sie den Ort in Polen besucht. Warum?
Meine Mutter hat mich nicht gebeten, Izbica zu besuchen. Niemand hat das getan. Ich musste gehen. Es war mir ein Bedürfnis, ihr Leben zu würdigen. Und bei meinem Besuch habe auch ich Spuren hinterlassen. Das ist meine eigene private Erfahrung. Ich wünschte, ich hätte es nicht vor der Kamera getan. Es war ein sehr privater und persönlicher Moment, bei dem ich nicht an die Kameras gedacht habe. Jetzt gehört der Moment der ganzen Welt.
Die Dokumentation zeigt viele emotionale Momente. Welcher hat Sie am meisten bewegt?
Der ganze Entstehungsprozess des Films hat mich bewegt. Diese Erfahrung war für mich von Anfang bis Ende bewegend, berührend, beunruhigend, verstörend und immer herausfordernd.
Was war besonders herausfordernd?
Es gab keine Momente der Neutralität. Aber am bewegendsten waren eigentlich die Dinge, die man nicht sieht. Momente, die es im Schnitt nicht in den Film geschafft haben. Für die Zuschauer ist vermutlich der bewegendste Moment das Zusammentreffen der Nachfahren: Hans-Jürgen Höss und Kai Höss, der Sohn und der Enkel von Rudolf Höß, kamen in die Wohnung meiner Mutter nach London. Es war ein historischer Moment. Es war das erste Mal, dass eine Überlebende, ihre Tochter und die Nachfahren eines NS-Massenmörders sich getroffen und miteinander gesprochen haben. Dabei hat mich meine Mutter sehr beeindruckt.
Inwiefern?
Sie begegnete Hans-Jürgen und Kai offen und mit großer Menschlichkeit. Das hat mich tief berührt.
Im Film gibt es auch ein Treffen ohne ihre Mutter. Ein zweites Mal haben Sie Hans-Jürgen und Kai Höss in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau getroffen. Wie war es für Sie, zusammen mit Hans-Jürgen und Kai Höss dort zu sein?
Ich wusste nicht, wie ich mich in ihrer Gegenwart fühlen würde. Darauf konnte ich mich nicht vorbereiten. Als wir uns schließlich dort von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden, erkannte ich, dass ihr Leid unüberwindbar groß und noch nicht aufgearbeitet worden war, auf keiner Ebene. Mir wurde bewusst, dass ich eine sehr große Aufgabe zu erfüllen hatte, um es diesen Männern zu ermöglichen, sich der Wahrheit ihrer Familiengeschichte zu stellen. Ich hatte das Gefühl, mich um sie kümmern zu müssen. Alle Emotionen gehörten also Hans-Jürgen Höss und Kai Höss.
Inwiefern haben Sie sich gekümmert?
In dem Moment war ich die Therapeutin und der Guide. Ich habe mich gefühlt wie ein Barometer. In Auschwitz gibt es keinen Platz für Sprache. Es gibt einfach keine Worte dafür. Hans-Jürgen und Kai Höss haben versucht, Worte zu finden. Sie wollten die Sprachlosigkeit mit Worten füllen. Ich vermittelte ihnen, dass es keine Worte braucht. Das war nicht immer einfach. Erst als es still wurde, hatten wir Raum zum Fühlen. Die Stille war der bewegendste Moment zwischen uns Dreien.
Stille ist nicht nur ein Thema des Films, sondern auch Teil der Erinnerung an die Shoah. Viele Überlebende haben sehr lange über die traumatischen Erfahrungen geschwiegen. Wie war das bei Ihrer Mutter?
Nach ihrer Befreiung wollten meine Mutter und ihre Schwester Renate unbedingt sprechen. Aber die Welt war nicht bereit, Fragen zu stellen. So richteten sie sich im "Hinterland des Schweigens" ein. Auch uns Kindern gegenüber schwieg sie. Denn wie erklärst du den eigenen Kindern, warum sie keine Großeltern mehr haben. Ich wusste immer, dass etwas nicht stimmte. Es war eine Art dunkles Geheimnis. So hat sich das Trauma auf mich übertragen. Meine Mutter wollte meinen älteren Bruder und mich nur beschützen. Als Kind fragte ich meine Mutter gelegentlich nach der Nummer auf ihrem Arm. Sie antwortete stets: "Ich erzähle es dir, wenn du älter bist." Aber diese Zeit kam nie wirklich.
Und wie haben Sie von der Vergangenheit ihrer Mutter erfahren?
Als ich als Teenagerin im Schrank nach Zigaretten suchte, fiel ein Stapel mit Fotos heraus. Die Fotografien lagen überall auf dem Boden um mich herum. Ich habe nicht verstanden, was ich da sah. Dann wurde mir klar, dass ich Leichen und schreckliche Bilder sah, die ich heute nur allzu gut kenne. Eine Person auf den Fotos sah aus wie meine Mutter. Erschrocken packte ich alles zurück in den Schrank. Ich wusste nicht, ob ich mich schuldig fühlte, Zigaretten gestohlen oder die Fotos entdeckt zu haben. Ich habe zehn Jahre nicht darüber gesprochen.
Sie haben das Trauma ihrer Mutter geerbt. Sind Sie deswegen Psychoanalytikerin geworden?
Ich bin schon immer ein neugieriger Mensch gewesen, der sich für Menschen interessiert. Es hat jedoch viele Jahre gedauert, bis ich den Mut hatte, eine Ausbildung zu machen. Teilweise auch, weil ich es geschafft hatte, jede formelle Schulausbildung zu umgehen, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war. Erst als ich fast 40 Jahre alt war, habe ich die Ausbildung zur Psychoanalytikerin angefangen.
Und wie gehen Sie heute mit dem Trauma um?
An manchen Tagen geht es mir besser, an anderen Tagen geht es mir schlechter. Die Wunden in mir sind sehr tief. Wenn ich Leid beschreibe, denke ich, dass es auf einer anderen Ebene liegt. Es ist nicht zu erklären. Die Menschen sehen, was sie sehen wollen, nur die erfolgreiche Psychotherapeutin und die Autorin - nicht die Auseinandersetzung, die damit einhergeht. Ich komme aus einer Familie von Shoah-Überlebenden, in der es eine Hierarchie des Leidens gibt. Ich selbst bin Teil der zweiten Generation. Ich beschäftige mich viel mit Fragen der Zugehörigkeit und Sicherheit. Ich beschäftige mich damit, welchen Platz ich im Leben und auf der Welt habe. Mein Trauma stammt nicht von einer von mir selbst erlebten Erfahrung, sondern entspringt der meiner Mutter, die sich auf mich übertragen hat.
"Der Schatten des Kommandanten" der deutsch-argentinischen Regisseurin Daniela Völker läuft ab dem 13. Juni im Kino.
Mit Maya Lasker-Wallfisch sprach Rebecca Wegmann.