Wettlauf mit der ZeitLiefern Fusionsreaktoren früh genug "endlos" sauberen Strom?
 Von Klaus Wedekind
Von Klaus Wedekind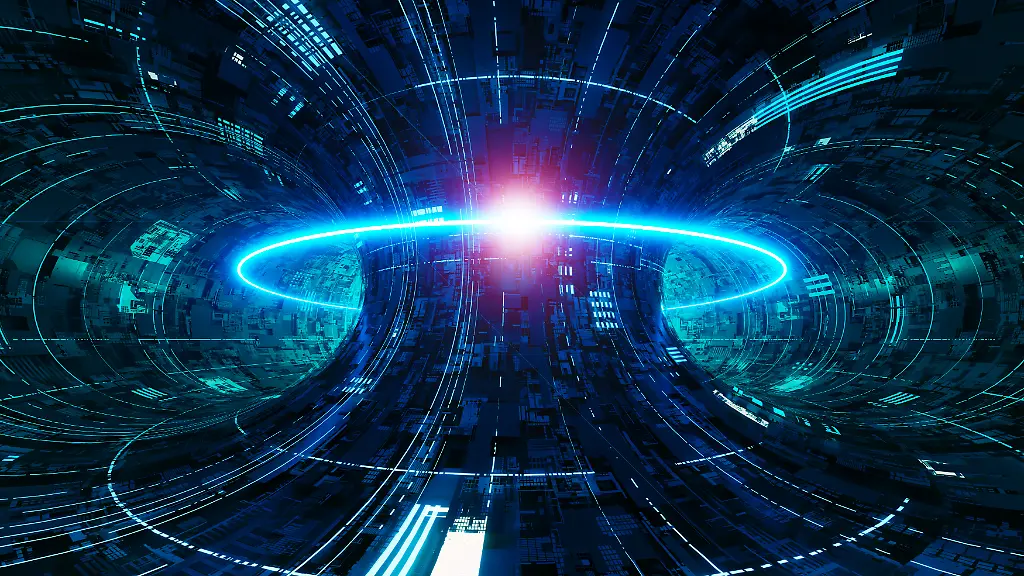
Fusionsreaktoren könnten die Lösung für die Energie- und Klima-Probleme der Welt sein, da sie theoretisch unerschöpflich und sauber Strom produzieren können. Doch werden sie schnell genug Realität, um schon bald den rasant ansteigenden Bedarf decken zu können?
Wenn es darum geht, bei der Stromerzeugung fossile Brennstoffe zu ersetzen, gilt es nicht nur, den aktuellen Bedarf zu decken. Prognosen der Bundesregierung nach treiben E-Fahrzeuge, Wärmepumpen in Gebäuden und Wärmenetzen, die Erzeugung von grünem Wasserstoff sowie die Produktion von Batterien den Bedarf steil nach oben. Erneuerbare Energien können vielleicht einen großen Teil davon abdecken, aber nicht 100 Prozent.
Eine Lösung könnten Fusionskraftwerke sein, die theoretisch in der Lage sind, unendlich viel und relativ sauberen Strom zu erzeugen. Die Technologie habe das Potenzial, ein Game-Changer für CO2-neutrale Energiesysteme zu sein, sagt Jan Wohland, Klimaforscher an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ). "Im Gegensatz zu Erneuerbaren gäbe es dann keine Wetterabhängigkeit in der Erzeugung. Kernfusion würde damit einige der Herausforderungen lösen, die beim Übergang zu Netto-Null existieren."
Weltweit wird intensiv an der Energiegewinnung durch Verschmelzung von Wasserstoff-Atomkernen bei extrem hohen Temperaturen geforscht. Deutschland betreibt unter anderem in Greifswald den Forschungsreaktor Wendelstein 7-X. Aber ist es realistisch, die Kernfusion als "Lösung all unserer Energieprobleme" zu sehen, wie es Ex-Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger im vergangenen März sagte?
Energiebedarf wächst enorm
Viel Zeit bleibt jedenfalls nicht. Laut dem aktuellen Projektionsbericht für Deutschland des Umweltbundesamts wird der Bruttostromverbrauch 2030 mindestens rund 660 TWh betragen, 2050 über 1000 TWh. Bei energischeren Maßnahmen zum Klimaschutz könnten es sogar 712 und 1150 TWh sein. Demgegenüber stehen prognostizierte Bruttostromerzeugungen der Erneuerbaren bis 2030 von 560 oder 571 TW beziehungsweise 940 oder 1009 TW bis 2050.
Weltweit steigt der Energiebedarf unter anderem durch den Bevölkerungszuwachs und höhere Lebensstandards ebenfalls enorm an. Der Weltenergierat erwartete 2020 eine Zunahme um rund 60 Prozent von 22.168 Terawattstunden (TWh) 2017 auf 35.277 TWh im Jahr 2040. Die U.S. Energy Information Administration (eia) rechnet im Vergleich zu 2020 mit einer Verdoppelung des globalen Energieverbrauchs bis 2050.
Ab 2040 Demonstrationskraftwerke möglich
Laut dem im März vorgestellten Programm des Bundesforschungsministeriums "2040 - Forschung auf dem Weg zum Fusionskraftwerk" soll in Deutschland "schnellstmöglich" ein Fusionskraftwerk gebaut werden. Dem Titel nach soll das womöglich schon in 16 Jahren der Fall sein. In Großbritannien hat man sich mit STEP ebenfalls das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2040 eine Anlage in Betrieb zu nehmen. Aber ist das realistisch?
Ja und nein. Kraftwerke, die relevante Strommengen erzeugen, sind bis dahin absolut nicht zu erwarten. Aber ein erster Schritt dorthin könnte bis dahin tatsächlich möglich sein. Das Forschungszentrum Jülich geht in einer Stellungnahme für den nordrhein-westfälischen Landtag davon aus, dass von der Entscheidung für den Bau eines Demonstrationskraftwerks bis zur Inbetriebnahme rund 20 Jahre ins Land gehen dürften. Kommerzielle Fusionsanlagen, die beispielsweise 5 bis 10 Prozent Grundlast liefern könnten, sieht das Forschungszentrum aber erst in etwa 30 Jahren.
Klaus Hesch hält ebenfalls ein funktionierendes Demonstrationskraftwerk in 20 Jahren für realistisch, allerdings nur "bei einem sehr ambitionierten und entsprechend mit Ressourcen ausgestatteten Programm." Hesch leitet das Fusionsprogramm des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).
Er hat gute Argumente dafür, die Forschung entschieden voranzutreiben. Wenn überhaupt, gelinge die Energiewende nur weltweit, sagt er. Und angesichts des Flächenbedarfs könne man nicht davon ausgehen, alles mit Windenergie und Fotovoltaik abzudecken. "Selbst Indien, wo die Voraussetzungen für Sonnenenergie optimal sind, setzt auf Fusion", sagt er. Außerdem sei Kernfusion im eigenen Land im Sinne der Energieunabhängigkeit sinnvoller als grünen Wasserstoff aus Übersee einzukaufen.
Zweifel an nationalen Alleingängen
Trotz des berechtigten Autarkie-Gedankens sind nationale Alleingänge möglicherweise nicht zielführend. "All-Electronics.de" sieht die internationale Zusammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg. Auch mit China, das nicht nur an internationalen Projekten wie ITER mitwirke, sondern auch eigene Reaktoren wie EAST und CFETR entwickle, schreibt Autor Martin Lange. Er weist darauf hin, dass nicht nur die technischen Herausforderungen, sondern auch die enormen Kosten internationale Kooperation erfordern.
Die Wirtschaftlichkeit ist ein entscheidender Faktor. Bisher gebe es aber keine verlässlichen Schätzungen der Investitionskosten für ein Fusionskraftwerk oder der Kosten für den durch die Fusion erzeugten Strom, schreibt das Forschungszentrum Jülich. "Daher ist es verfrüht zu behaupten, dass durch Fusion erzeugter Strom mit erneuerbaren Energien wettbewerbsfähig sein wird."
Erneuerbare deutlich günstiger, aber …
Einer bei Agora Energiewende veröffentlichten Erhebung von BloombergNEF nach kostete 2022 eine mit Windenergie (Onshore) erzeugte Megawattstunde (MWh) 57,50 Dollar, mit Fotovoltaik produzierter Strom lag bei 55 Dollar pro MWh. Wind und Sonne sind allerdings nicht in der Lage, wetterunabhängig Energie zu erzeugen. Daher sind höhere Kosten für Strom von Kraftwerken, die unabhängig und nach Bedarf liefern können, bis zu einem gewissen Grad gerechtfertigt - speziell, wenn sie umweltfreundlich arbeiten.
Laut einer bei "ScienceDirect" veröffentlichten Studie der University of Wisconsin könnte eine mit frühen Fusionskraftwerken gewonnene Megawattstunde mehr als 150 Dollar kosten. Um 2040 wettbewerbsfähig zu sein, müssten die Kosten jedoch bei 80 bis 100 Dollar pro MWh liegen, wenn man den Preis von 2020 zugrunde lege, schreiben die Forschenden. Sie empfehlen daher, sich auf Anlagen mit höherem Wirkungsgrad und größeren Kapazitäten zu konzentrieren.
Damit bleiben kommerzielle Fusionskraftwerke vorerst Zukunftsmusik, wie Martin Large bei "All-Electronics.de" schreibt. Die nächsten Jahre würden entscheidend, um zu beurteilen, ob die ambitionierten Ziele der Forscher und Unternehmen erreicht werden könnten. Aktuell betrieben die Beteiligten eine milliardenschwere Wette, denn eine Garantie, dass die Kernfusion wirtschaftlich funktionieren wird, gebe es nicht.