Satelliten im VisierWas soll man von Putins Atom-Weltraumwaffe halten?
 Von Klaus Wedekind
Von Klaus Wedekind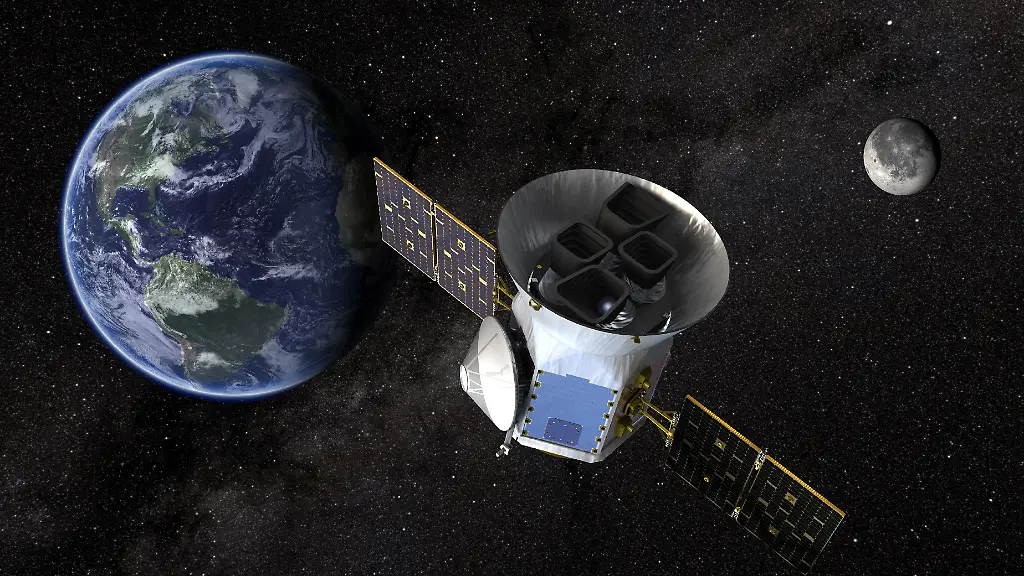
Russland entwickelt offenbar ein neues Waffensystem, das im Weltraum stationierte Satelliten zerstören soll, möglicherweise mit Atomraketen. Wie überraschend ist das, wie gefährlich wäre der Einsatz solcher Waffen und was bringt das Putin?
US-Regierungssprecher John Kirby hat bestätigt, dass Geheimdiensterkenntnissen zufolge Russland eine neue Anti-Satelliten-Waffe entwickelt. Dies stelle ein ernstes nationales Sicherheitsrisiko, aber keine akute Bedrohung für Amerikaner dar, sagt er in einer Pressekonferenz. Nähere Details, um was für ein System es sich dabei handeln könnte, nannte Kirby nicht, aber seine kurze Ansprache war trotzdem aufschlussreich.
Atomwaffen beschrieben, aber nicht genannt
Kirby sagte nämlich, es handle sich um "weltraumbasierte" Waffen, die gegen den Weltraumvertrag von 1967 verstießen, der die Stationierung von Massenvernichtungswaffen im Weltraum verbiete und den Russland unterzeichnet habe. Ist das zutreffend, kann es sich nicht nur um "Killer-Satelliten" mit nuklearem Antrieb handeln, die nicht gegen den Vertrag verstoßen würden, sondern wahrscheinlich um Atomwaffen.
Wirklich überraschend ist die Nachricht nicht, denn schon länger warnen Experten vor entsprechenden russischen Ambitionen. Im Februar 2023 schrieb der Direktor des Nationalen Geheimdienstes der USA in seiner jährlichen Bedrohungsanalyse, Russland entwickele, teste und setzte eine Reihe von nicht destruktiven und destruktiven Weltraum-Abwehrwaffen ein. Darunter befänden sich Stör- und Cyberspace-Waffen, Energiewaffen, im Orbit stationierte sowie bodengestützte Anti-Satelliten-Waffen.
Unkontrollierbare Massenvernichtung
Es gibt also offensichtlich andere Möglichkeiten, gegnerische Satelliten zu bekämpfen. Mit Nuklearwaffen könnte man aber nicht nur einzelne Objekte zerstören, sondern viele. Eine große Menge Satelliten würde schon in unmittelbarer Nähe einer Explosion zerstört oder beschädigt, viele weitere im Laufe der folgenden Wochen und Monate.
Das weiß man im Prinzip schon seit 1962, als die USA in 400 Kilometern Höhe eine von einer Rakete getragene Atombombe detonieren ließen. Der "Starfish Prime" genannte Test zerstörte unter anderem alle damals existierenden Satelliten und führte auch auf der Erde zu Ausfällen. Damals gab es nur sieben Satelliten, heute befinden sich laut Statista mehr als 7500 im Orbit. Allein Elon Musks Starlink-System besteht aus mehr als 5700 Satelliten.
Nur besonders geschützte Satelliten haben eine Chance
Eine unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs entstandene Studie des Center for Strategic & International Studies (CSIS) erklärt ausführlich, welche Folgen heute eine Atomexplosion im Orbit hätte. Zunächst zerstörten demnach hochenergetische Röntgenstrahlen die Elektronik aller Satelliten, die nicht von der Erde verdeckt werden.
In den folgenden Wochen würden die durch die Explosion erzeugten geladenen Teilchen von den natürlichen Strahlungsgürteln der Erde eingefangen und über den Globus verteilt werden, wodurch alle Satelliten beschädigt würden. Davon wären natürlich auch russische Satelliten betroffen. Lediglich besonders geschützte Satelliten blieben verschont.
Unmengen von Weltraumschrott
Hinzu kommt das Problem des Weltraumschrotts in den Umlaufbahnen, dessen Menge durch einen Atomwaffeneinsatz dramatisch anwachsen könnte. "Müllobjekte größer als etwa zehn Zentimeter sind bei typischen Relativgeschwindigkeiten von 10 -14 Kilometern pro Sekunde auf erdnahen Bahnen in der Lage, einen Satelliten oder eine orbitale Raketenstufe vollständig zu zerlegen", schreibt die Europäische Weltraumorganisation ESA. Dabei entstünden wiederum hunderte bis tausende neue Objekte.
Laut ESA-Statistik schwirren durch den Orbit derzeit rund 36.500 Müllstücke dieser Größe. Aber auch kleinere Objekte sind gefährlich. Etwa eine Million sind ein bis zehn Zentimeter groß und können "die Mission eines operationellen Satelliten beenden." 130 Millionen Objekte messen nur zwischen einem Millimeter und einem Zentimeter. Trotzdem sind sie laut ESA in der Lage, Energieversorgung, Kommunikationssysteme, Teile der Bahn- und Lagesteuerung des Satelliten oder Sensoren von Forschungsinstrumenten "nachhaltig zu schädigen".
Will Putin nur prahlen?
Welchen Sinn ergäbe für Russland also eine weltraumbasierte, nukleare Anti-Satelliten-Waffe? Robert M. Soofer denkt dabei an die Gefahr, Russland könne versuchen, bei einem atomaren Erstschlag eine US-Vergeltung zu verhindern, indem es die dafür nötigen Satelliten (Überwachung, Kontrolle, Führung) zerstört. Soofer leitet das Scowcroft Center for Strategy and Security des Atlantic Council.
Wie zuvor die Entwicklung transkontinentaler Unterwasser-Atomtorpedos und nuklear betriebener/atomar bewaffneter Marschflugkörper könnten nukleare Weltraumwaffen allerdings Russlands Fähigkeit, den USA zu drohen, nur wenig stärken, sagt er. Trotzdem fordert Soofer, dass die USA ihre Atom- und Weltraum-Streitkräfte weiter modernisieren, um sicherzustellen, dass kein Gegner "jemals an einen erfolgreichen entwaffnenden Erstschlag gegen die Vereinigten Staaten denken kann."
Soofers Kollege Mark J. Massa, der im Scowcraft Center Vize-Direktor der Abteilung Forward Defense Practice ist, sieht das ähnlich. Denn auch jetzt könne schon jedes Land, das über eine nuklear bewaffnete Interkontinentalrakete (ICBM) verfügt, eine Atomwaffe im Weltraum zünden, schreibt er als Co-Autor in einem Beitrag für das Atlantic Council.
Möglicherweise ginge es Putin nur darum, Russlands militärische Stärke unter Beweis zu stellen, zitiert "Time" Robert M. Soofer. Er wolle entweder Stärke nach innen demonstrieren oder er versuche, den Rest der Welt dazu zu bringen, die Größe Russlands wertzuschätzen.
Drei Fliegen mit einer Klappe
Bleibt noch die Frage, warum der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Repräsentantenhaus, Mike Turner, ausgerechnet jetzt die möglichen russischen Pläne offengelegt hat. Thomas S. Warrick, Direktor des Future of DHS-Projekts in der Abteilung Forward Defense Practice, nennt mögliche Motive.
Erstens versuchten Demokraten und Republikaner seit Monaten, den Kongress dazu zu bringen, eine wichtige Berechtigung für die Sammlung ausländischer Geheimdienste gemäß Abschnitt 702 des Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) zu erneuern. Turner habe offengelegt, dass die neue Bedrohung durch Geheimdienstinformationen aufgedeckt wurde, die im Rahmen der Zuständigkeit von Abschnitt 702 gesammelt wurden, schreibt Warrick.
Hinzu komme, dass viele Repräsentanten den Umweg zu aus Sicherheitsgründen abgelegenen Räumen des Geheimdienstausschusses scheuten, um sich dort zu informieren. Turner hoffe möglicherweise, dass seine Aktion die Politiker dazu bringen könnte, sich mit den Fakten auseinanderzusetzen und dann entsprechend abzustimmen. Ein weiterer Grund liegt auf der Hand: Turner wolle den Repräsentanten klarmachen, dass Russland eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt, und sie Verbündete und Partner, einschließlich der Ukraine, unterstützen sollten, so Warrick.