Stromspeicher, CO2-Sauger, SpritRettet Elektrochemie die grüne Welt?
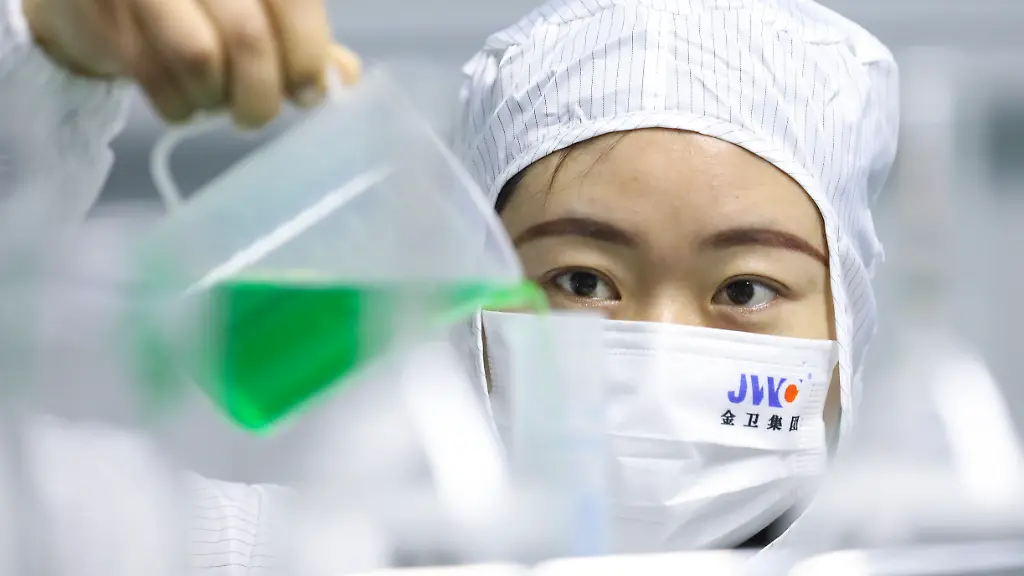
Ohne Elektrochemie fällt die Energiewende aus. Denn das Fachgebiet entscheidet maßgeblich über Erfolg oder Misserfolg fast jeder künftigen Energielösung. Besonders groß ist die Vorfreude am Fraunhofer-Institut UMSICHT bei der CO2-Wandlung, wie der verantwortliche Chemiker im "Klima-Labor" verrät.
Ohne Elektrochemie fällt die Energiewende aus. Denn das naturwissenschaftliche Fachgebiet entscheidet maßgeblich über Erfolg oder Misserfolg so ziemlich jeder künftigen Energielösung: Größere und bessere Batterien? Check. Grüner Wasserstoff? Check. CO2 aus der Luft saugen? Check. E-Fuels? Check. Bei Ulf-Peter Apfel am Fraunhofer-Institut UMSICHT stehen deshalb schon seit einiger Zeit die Telefone nicht mehr still: "Industriekonzerne, aber auch Partner aus der Forschung sagen: Hey, wir müssen was tun, lasst uns was umsetzen!", erzählt der Chemiker im "Klima-Labor" von ntv. In seiner Abteilung werden aber nicht nur ältere Technologien verbessert, verfeinert und skaliert, sondern auch ganz neue Ansätze entwickelt. Besonders groß ist die Vorfreude auf die funktionierende CO2-Wandlung: Apfel und sein Team wollen emissionshaltige Abgase zum Beispiel in Zementwerken einfangen - und daraus elektrochemisch neue Grundstoffe für andere Anwendungen zaubern.
ntv.de: Warum ist Elektrochemie so wichtig für die Energiewende?
Ulf-Peter Apfel: Von Elektrochemie hören Sie immer und immer wieder, auch in den Medien. Nämlich immer dann, wenn von Power-to-X-Verfahren wie E-Fuels die Rede ist. Dahinter verbirgt sich Strom, der in irgendetwas umgewandelt und meistens in chemischen Bindungen gespeichert wird. Das ist Elektrochemie.
Windräder auch?
Ja. Sie können Windenergie oder Sonnenenergie nicht speichern, sondern brauchen Stromspeicher wie Batterien, in denen chemische Prozesse passieren. Oder Sie nehmen den Strom, um Wasserstoff herzustellen. Auch das ist Elektrochemie.
Kann man dann sagen, dass es ohne Elektrochemie gar keine Energiewende gäbe?
Größtenteils. Wenn wir über Erneuerbare reden und davon ausgehen, dass wir für deren Einsatz Zwischenspeicher oder ganz neue Formen von Energiespeichern brauchen, die man eventuell auch transportieren kann, ist Elektrochemie ein signifikanter Teil davon.
Diese Zwischenspeicher sind ja der Knackpunkt, wenn wir allein mit Wind- und Sonnenenergie auskommen wollen. Zeitweise gibt es sehr viel davon, manchmal aber auch gar nichts - die berühmte Dunkelflaute. Auf welchem Niveau befinden wir uns in diesem Bereich im Moment?
Wir sind weit. Batterien sind eine ewig alte Technologie, auch Wasserstoff wird seit 100 Jahren bei der Elektrolyse hergestellt. Die Problematik ist hauptsächlich, dass diese Systeme noch teuer in der Anwendung sind. Aktuell ist es billiger, Wasserstoff aus Erdgas zu generieren, als Wasser mit grünem Strom umzuwandeln - auch, weil Elektrolyseure derzeit noch händisch hergestellt werden. Es läuft wirklich wie früher im alten Handwerksbetrieb: Jemand stellt sich hin und schraubt Komponente A an Komponente B und Komponente C. Das läuft nicht wie beim Auto automatisiert am Band, aber in diese Richtung passiert sehr viel. Ein zweites Problem ist, dass viele Dinge noch nicht für die Größenskalen ausgelegt sind, die wir erreichen müssen. Zum Teil fehlen zudem notwendige Rohstoffe. Deswegen wird auch an alternativen Komponenten geforscht.
Es gibt also keinen Bedarf an großen Entdeckungen oder Revolutionen, sondern vor allem an besseren Prozessen? Die Technologien an sich sind ausgereift?
Nein, beim besten Willen nicht, auch in diesem Bereich gibt es aus chemischer Sicht viel zu tun. Ein Schlüsselelement einer Brennstoffzelle ist zum Beispiel die sogenannte Membran-Elektroden-Einheit. Wie kann man solche Membranen besser und langlebiger gestalten? Wie sorgt man dafür, dass die ohne hochreinen Substanzen funktionieren? In älteren Systemen werden zum Beispiel alkalische Elektrolytsysteme mit starken Basen eingesetzt. Das kennen Sie vom Kloreiniger: Ätzend, bitte aufpassen. Das ist hochkorrosiv und belastet das Material, eine Elektrolysezelle muss das aushalten. Wenn Sie solche Substanzen aber gar nicht verwenden wollen, sondern nur Wasser, brauchen Sie andere Katalysatoren. Das Problemfeld ist riesig, es gibt aber viele Entdeckungen in dem Bereich.
Auch bei Ihnen am Fraunhofer-Institut? Das "Wall Street Journal" hatte zuletzt von einem Boom in der Elektrochemie berichtet.
Ja, sehr. Großen Dank muss man an Fridays For Future richten, denn die haben das Thema auf die Agenda gebracht. Seitdem kommen Industriekonzerne, aber auch Partner aus der Forschung auf uns zu und sagen: Hey, wir müssen was tun, lasst uns was umsetzen! Eigentlich steht unser Telefon nicht mehr still …
Die Elektrochemie betrifft ja wirklich alle Bereiche der Energiewende. Wir haben über die Wasserstoffherstellung gesprochen, Batterien und Energiespeicher wurden ebenfalls angerissen. Auch beim Carbon Capture, also beim Einfangen von CO2, spielt sie eine wichtige Rolle - welcher Bereich ist davon am wichtigsten? Sollten wir uns auf einen konzentrieren?
Man muss alles untersuchen. Wir brauchen neue Batterietechniken abseits der Lithium-Ionen-Batterie. Nickel-Eisen-Batterien, Nickel-Luft-Batterien, Redox-Flow-Batterien sind unterschiedliche Energiespeicher, die gebraucht werden und weiterentwickelt werden müssen. In der Elektrolyse brauchen wir ebenfalls unterschiedliche Systeme, die nicht nur Wasserstoff erzeugen. Wir forschen in meiner Abteilung zum Beispiel an der direkten CO2-Umwandlung. Sie entnehmen also das CO2 aus dem Abgas und wandeln es elektrochemisch in etwas um, das sie in der chemischen Industrie verwenden können.
Wie schnell können wir denn mit neuen Lösungen rechnen, die uns voranbringen?
Ich bin kein großer Freund von Deadlines. Natürlich agieren wir selbst so und versuchen, sie einzuhalten, aber es wäre eine falsche Versprechung zu sagen: Bis 2025 haben wir ein Elektrolyse-System am Markt, das CO2 umwandeln kann. Aber wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, muss ich sagen: Es ist so viel passiert, was ich anfangs für unvorstellbar gehalten habe. Es gibt neue Katalysator-Systeme am Markt, erfolgreiche Start-ups in dem Bereich und in kleineren Versionen bereits Elektrolysezellen, die kommerzialisiert sind.
Das gilt für die Bereiche Elektrolyse, Batterien und Energiespeicher oder auch für den Bereich Carbon Capture?
Auch für den Carbon-Capture-Bereich. Wir adressieren bei der CO2-Elektrolyse derzeit hauptsächlich die Zementindustrie. Die wird ihren CO2-Ausstoß nur begrenzt reduzieren können. Das liegt einfach an den chemischen Prozessen, dabei entsteht immer CO2. Das geht nicht anders. Aber man kann das CO2 wieder verwerten. Und wenn wir an Direct-Air-Capture-Prozesse (DAC) denken, bei denen CO2 aus der Luft gesaugt wird, hätte ich vor fünf Jahren noch gesagt: Wer braucht denn so etwas? Das ist obsolet und nicht energieeffizient. Die Systeme sind noch nicht kompetitiv, aber sie werden immer besser und in ein paar Jahren vielleicht so gut und ausgereift, dass man sie wirklich im großen Stil einsetzen kann. Und selbst, wenn sie dann immer noch nicht lukrativ sind, sind wir ja irgendwann dazu gezwungen, sie einzusetzen. Dann müssen wir uns über diese Technologien sowieso Gedanken machen. Deswegen ist es wichtig, sie jetzt schon zu entwickeln.
Bei welchem Projekt ist denn Ihre Vorfreude am größten?
Das ist schwierig, weil man als Wissenschaftler ja ein Spielkind ist und am liebsten alle Dinge umsetzen möchte. Aber aus meiner direkten Forschung würde ich den Container-basierten Elektrolyseur für die CO2-Wandlung nennen. Den bauen wir derzeit zusammen. Wenn der irgendwann an einer industriellen Quelle steht und funktioniert, haben wir wirklich etwas erreicht.
Was genau muss man sich darunter vorstellen?
Wenn wir CO2-Gase nutzen und durch unsere Elektrolysezelle pumpen … können wir die nicht chemisch in etwas umwandeln, das wir nutzen können? Wir arbeiten zum Beispiel sehr viel mit Synthesegas. Das ist eine Mischung aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff und wird direkt in diesem Elektrolyseur erzeugt. Auf diese Weise hat Südafrika zur Zeit der Apartheid seine ganze Chemie und seinen ganzen Sprit hergestellt, weil die von sämtlichen Ölimporten abgeschnitten waren. Das ist ewig alte Fischer-Tropsch-Chemie, die gibt es seit dem Ersten Weltkrieg, und man kann sie als Grundlage nutzen, um Ausgangsstoffe der chemischen Industrie zu ersetzen. Das ist unser Ziel.
Die berühmten E-Fuels?
Genau. Aus diesem Synthesegas können sie Diesel, aber auch Methanol oder Ethanol herstellen. Je nachdem, was sie brauchen. Sie können das CO2 auch direkt in einen Elektrolyseur pumpen und daraus Ethylen herstellen, also eine Plastiktüte oder eine Plastikflasche. Solche Dinge sind möglich.
Und Sie sind optimistisch, dass wir auf diese Weise bald CO2-neutralen Sprit in vernünftigen Mengen herstellen könnten?
Ja. Man muss sich allerdings vergewissern, dass der E-Fuel anfangs deutlich teurer sein wird als Treibstoff aus Fossilen. Aber über die Zeit wird es billiger. Wenn ich an die Preise für Elektrolyseure von vor fünf Jahren denke, sind sie bereits massiv gesunken.
Um wie viel denn ungefähr?
Wir haben vor Jahren mal gesagt, dass wir die Kosten für eine Anlage auf unter 500 Euro pro Kilowattstunde drücken wollen. Das haben wir längst geschafft.
Aber wenn wir mit diesen Elektrolyseuren E-Fuels herstellen, fehlen die dann nicht für die Wasserstoffherstellung?
Nein, überhaupt nicht. Sie müssen sich vergegenwärtigen: Wenn wir unsere Industrie auf Wasserstoff umstellen, reden wir von enormen Mengen, die wir vielleicht nicht immer brauchen. Dann haben Sie mit den E-Fuels eine Alternative. Das sollte aber nicht das primäre Ziel sein.
Mit Ulf-Peter Apfel sprachen Clara Pfeffer und Christian Herrmann. Das Gespräch ist zur besseren Verständlichkeit gekürzt und geglättet worden.